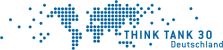März 2011
Think Tank 30: Herr Professor Berg, die Nachrichten aus dem Katastrophenreaktor in Fukushima reißen nicht ab: Wasserstoffexplosionen, radioaktive Wolken, eine mögliche Kernschmelze. Immer wieder müssen die Arbeiten abgebrochen werden. Steht uns ein zweites Tschernobyl bevor?
Christian Berg: Wie genau die Folgen sein werden, kann heute wohl noch niemand sagen. Es sieht im Moment aber wohl leider danach aus, dass die Folgen ähnlich, wenn nicht sogar schlimmer werden können wie in Tschernobyl. Allerdings halte ich dies auch nicht für entscheidend bei der Bewertung von Kernenergie. Entscheidend ist doch, dass keine 25 Jahre nach Tschernobyl wieder eine Reaktorkatastrophe passieren konnte. Auf technischen Unterschieden zu beharren, nach dem Motto: „Bei uns kann das nicht passieren”, lenkt aus meiner Sicht von der entscheidenden Frage ab: sind wir als Gesellschaft bereit, dieses sogenannte “Restrisiko” zu tragen.
Die Japanische Atombehörde wirft dem Fukushima-Betreiber Tepco Schlamperei vor. Angeblich wurden vor dem Unglück Anlagen nicht ordnungsgemäß geprüft. Hätte die Katastrophe abgewendet werden können?
Christian Berg: Dass „ein Unglück selten allein kommt”, liegt natürlich daran, dass Unglücke sich oft erst als Verkettung von mehreren, sehr ungünstigen Umständen ergeben. Die vielen kleineren Störfälle oder Beinahe-Katastrophen bekommen wir häufig gar nicht mit – und das gilt nicht nur für Kernkraftwerke. Hinterher ist man immer schlauer. Nur: wer will garantieren, dass nicht in anderen Fällen auch Schlampereien vorkommen.
Die EU-Energieminister der 27 Mitgliedstaaten trafen sich in Brüssel, um über mögliche Konsequenzen der Havarie in Fukushima zu beraten. Ist der Atomunfall in Japan der letzte Beweis dafür, dass eine energiepolitische Wende auch in Europa unumgänglich ist?
Christian Berg: Ich glaube, dass diese Energiewende auch global unausweichlich ist – die Frage ist nur, wann das zum Handeln führt. Die Energiewende ist aber nicht nur unausweichlich, sie ist auch möglich. Beispiel solare Energienutzung: Die Sonne liefert allein in den Wüsten dieser Erde in wenigen Stunden genug Energie, um damit den Energiebedarf der gesamten Menschheit ein ganzes Jahr lang zu decken. Dies will ja Desertec nutzen – ein Projekt, das übrigens der deutsche Club of Rome jahrelang praktisch unbeachtet vorangetrieben hat, bis vor zwei Jahren auch in den Medien der Durchbruch kam. Sicherlich ist bis dahin noch viel zu tun und es sind noch viele Probleme zu bewältigen – hinsichtlich Energiespeicherung, Energieübertragung, oder auch Netzstabilität. Aber das ist vor allem eine Frage des politischen Willens und der nötigen Investitionen, weniger eine Frage der technischen Machbarkeit.
Konfliktstoff bieten derzeit die geplanten Sicherheitschecks für Atomkraftwerke in Europa. Beim EU-Ministertreffen kritisierten einige Länder, dass bislang niemand richtig wisse, wie die von EU-Kommissar Günther Oettinger angekündigten Stresstests funktionieren sollten. Was halten Sie von diesen Tests?
Christian Berg: Meine spontane Assoziation zu Oettingers Ankündigung war: Auch Tschernobyl begann mit einem Test… Natürlich geht es hier um eine ganz andere Art von Test – aber die eigentliche Frage ist doch, wie man ein Risiko bewertet und welche Größe man dem zugehörigen Bilanzraum einräumt. Versicherungstechnisch ist ein Risiko das Produkt aus “Eintrittswahrscheinlichkeit” und “Schadenshöhe”. Was die Eintrittswahrscheinlichkeit betrifft, mögen die Fachleute sagen, dass sie sehr gering sei – offenbar aber leider nicht gering genug. Betrachtet man die Schadenshöhe, stellen sich viele Fragen: Wie bewertet man die Zwangsumsiedlung von hunderttausenden von Menschen, wie die ökonomischen Verluste aufgrund von Einnahmeausfällen der betroffenen Unternehmen, wie die aufwendigen Sanierungen, ganz zu schweigen von den vielen Todesfällen? Wie will man bilanzieren, dass ganze Regionen auf hunderte, wenn nicht auf tausende von Jahren unbewohnbar werden, dass in vielen Ländern Kontrollen zur Lebensmittelsicherheit erforderlich werden, dass die Radioaktivität über das Meer in die Nahrungskette gelangt – mit unabsehbaren Folgen weit über Japan hinaus?
Natürlich darf man angesichts der vielen damit verbundenen menschlichen Tragödien nicht rein wirtschaftlich argumentieren. Aber auch ökonomisch müssen wir uns im Klaren sein, dass eine solche Katastrophe auf sehr lange Zeit Kosten verursacht. Caesium 137, das auch in Tschernobyl in großen Mengen in die Umwelt gelangte, hat eine Halbwertszeit von etwa 30 Jahren. Das bedeutet, dass nach einhundert Jahren immer noch etwa ein Zehntel der ursprünglichen Strahlung vorhanden ist. Plutonium 239 hat sogar eine Halbwertszeit von mehr als 24 000 Jahren. Hätten die ersten Höhlenmenschen solche Radioaktivität freigesetzt, würden wir sie heute noch fast genauso stark spüren. Kein Betreiber, und auch keine Versicherung, kann für diese langfristigen Schäden aufkommen. Die Kosten werden also von den betroffenen Gesellschaften zu tragen sein, sie werden sozialisiert und vererbt. Erinnert das nicht an die Finanzkrise? Auch hier werden Kosten sozialisiert und vererbt – wollen wir das wirklich?
Bei dieser Betrachtung noch völlig unberücksichtigt sind die Kosten für die immer noch ungeklärte Endlagerung. Die Behauptung, dass Kernenergie wirtschaftlich sei, ist nur dann richtig, wenn der Bilanzraum unbegründet klein gemacht wird. Mathematisch gesprochen haben wir das Problem, dass wir eine sehr kleine, mit Unsicherheit behaftete Zahl (die Eintrittswahrscheinlichkeit) mit einer sehr großen, ebenfalls mit Unsicherheit behafteten Zahl (der Schadenshöhe) multiplizieren. Das Ergebnis zu beurteilen ist eine Herausforderung, die man nicht allein den “Experten” zuweisen kann. Dies muss von einem breiten gesellschaftlichen Konsens getragen werden.
Fünf EU-Länder drängen jetzt auf einen europaweiten Ausstieg aus der Kernenergie. Zum Beispiel Österreich und Luxemburg. Widerstand gibt es aus Frankreich und Deutschland. Wie wird die Zukunft in Sachen Atomenergie in der EU Ihrer Meinung nach aussehen?
Christian Berg: Wir wissen zu Genüge, wie schwierig einheitliche Regelungen EU-weit durchzusetzen sind. Aber so wie in einer gemeinsamen Währungs- und Wirtschaftsunion gemeinsame Aktionen zur Abwehr von Risiken erforderlich sind – siehe Euro-Rettungsschirm -, so werden wir auch die aus der Nutzung von Kernenergie entstehenden Risiken gemeinsam zu bewältigen haben. Denn die Strahlung macht nicht an den Grenzen halt.
Sollten in der EU kurzfristig viele Kernkraftwerke abgeschaltet werden, könnte es schwieriger werden, die gemeinsamen Klimaziele zu erreichen, denn noch stehen erneuerbare Energien wie Wind- und Wasserkraft nicht ausreichend zur Verfügung. Mehr Strom müsste also in Kohle- und Gaskraftwerken produziert werden. Die verursachen aber große Mengen klimaschädlichen Kohlendioxids. Ein Dilemma, das die Atom-Lobby begünstigt?
Christian Berg: Das ist sicherlich so. Für die Klimabilanz sind abgeschriebene Reaktoren vorteilhaft. Im Übrigen auch für die wirtschaftliche Bilanz. Um so wichtiger, dass wir schnell in den Ausbau erneuerbarer Energien, in Netzinfrastruktur und Energiespeicherung investieren – auch in entsprechende Forschung und Entwicklung.
In Deutschland hat die Bundesregierung nach dem Atomausfall acht Kernkraftwerke abschalten lassen: Nur eine Schock-Reaktion? Oder ein ernsthafter Ansatz für eine Abkehr von der Atomenergie?
Christian Berg: Für mich ist der „Austieg-vom-Austieg-vom-Austiegs-Beschluss” ein Symptom für eine zunehmend opportunistische Politik. Warum wurde ein so breiter gesellschaftlicher Konsens wie der Atomausstieg leichtfertig geopfert? „Ernsthaft” würde ich hier vor allem das Bemühen nennen, die nächsten Wahlen nicht zu verlieren.
Der langjährige Abteilungsleiter für Reaktorsicherheit im Bundesumweltministerium, Wolfgang Renneberg, sieht zwischen den alten und neuen AKWs in Deutschland ein „Unterschied wie Tag und Nacht”. Müssen nur die alten AKWs eingemottet werden?
Christian Berg: Auch neue Reaktoren haben ein „Restrisiko”. Die Frage nach der Akzeptabilität von Kernenergie entscheidet sich meiner Meinung nach nicht an graduellen Verbesserungen.
Schon jetzt würden 3500 Kilometer Stromnetz in Deutschland fehlen, sagt Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle. „Wenn wir noch schneller auf die regenerativen Energien umsteigen, brauchen wir noch mehr Netze.” Was also tun?
Christian Berg: In die Netzinfrastruktur investieren. Knappheit ist schon oft der Antrieb für Innovation gewesen. Auch die Ökosteuer hat diesen Innovationsanreiz mit sich gebracht und ihren Teil dazu beigetragen, dass wir heute in vielen Umwelttechnologien weltweit führend sind.
Das Interview führte tt30 Mitglied Sophia Seiderer.